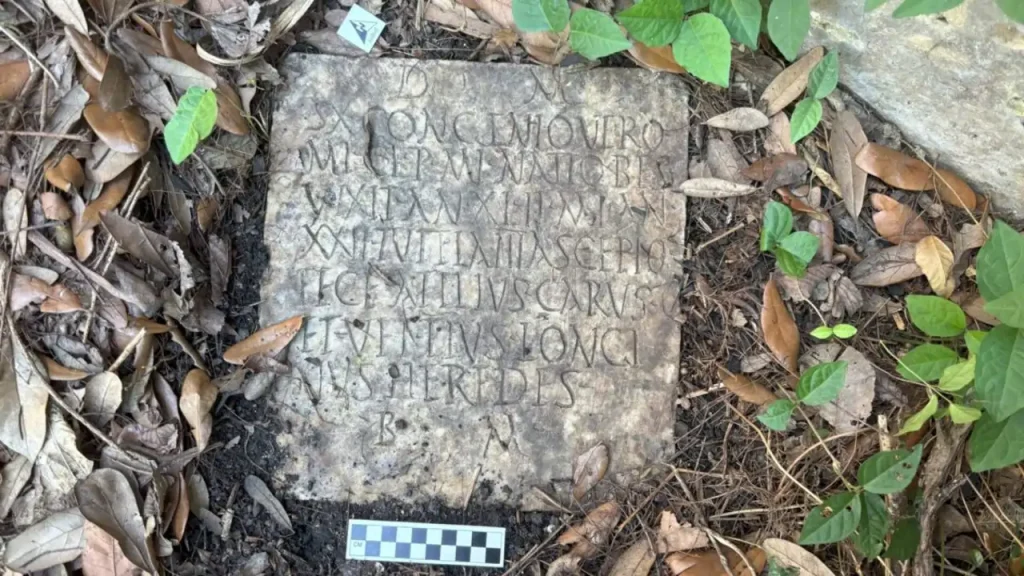Untersuchungen zeigen, dass das Elfenbein, aus dem im südlichen Levantegebiet kunstvolle Gegenstände hergestellt wurden, von afrikanischen Elefanten stammte.

Elfenbein war eines der wertvollsten Luxusgüter in der Gesellschaft des Alten Nahen Ostens. Im südlichen Teil der Levante waren Elfenbeinarbeiten ein Synonym für Luxus, Macht und kulturelle Raffinesse. In der späten Bronzezeit, als die Vorherrschaft des Neuen Reiches in Ägypten ihren Höhepunkt erreichte und mehrere kanaanitische Stadtstaaten unter seine Herrschaft fielen, wurde Elfenbein zur Herstellung von luxuriösen Möbeln, dekorativen Schatullen und Votivgaben verwendet.
In der frühen Eisenzeit, als der Einfluss der kanaanitischen Stadtstaaten und die Vorherrschaft Ägyptens in der Region endeten, verschwanden Elfenbeinprodukte aus dem nördlichen Levante, blieben jedoch im Süden, insbesondere entlang der phönizischen und philistäischen Küste, erhalten. Darüber hinaus veränderte sich auch die Funktion von Elfenbein, das nun nicht mehr für Luxusgüter, sondern für Alltagsgegenstände wie Spindeln für Webstühle oder Kämme verwendet wurde.
Trotz all dieser politischen und kulturellen Veränderungen war Elfenbein weiterhin verfügbar, aber Wissenschaftler fragen sich: Woher kam es tatsächlich? In einer kürzlich im Journal of Archaeological Science veröffentlichten Studie kommt eine Forschergruppe unter der Leitung von Harel Shohat, Archäologe an der Universität Haifa, zu dem Schluss, dass das Elfenbein, aus dem die im südlichen Levante gefundenen Gegenstände hergestellt wurden, von Elefanten stammte, die tief im Inneren Afrikas gejagt wurden.
Ein lukratives Geschäft
Die Studie, die den Zeitraum von 1600 bis 600 v. Chr. abdeckt, liefert die ersten eindeutigen Beweise für die geografische Herkunft des Elfenbeins im Levante und widerlegt offenbar die traditionellen Behauptungen über das Monopol Ägyptens auf den Elfenbeinhandel. Laut Shochat „waren nubische Händler fast tausend Jahre lang an der Aufrechterhaltung von Fernhandelsnetzen beteiligt“.
Für ihre Studie analysierten Shochat und sein Team 624 Elfenbeinarbeiten mithilfe von Mikroskopie, Proteomik und Stabilisotopenanalyse. Die Ergebnisse zeigten, dass etwa 85 % der Objekte aus dem Knochen afrikanischer Elefanten, etwa 15 % aus dem Knochen von Flusspferden und einige aus den Stoßzähnen von Wildschweinen hergestellt wurden.
Die Analyse des Knochen von Flusspferden ergab, dass dieser sowohl aus lokaler Produktion stammte als auch aus dem Nil importiert worden war. Gleichzeitig deuten Isotopendaten darauf hin, dass der Elfenbein ausschließlich aus den Waldgebieten des Oberlaufs des Weißen Nils südlich von Khartum im heutigen Sudan stammt. Dies könnte bestätigen, dass nubische Händler Elfenbein durch kleine Tauschgeschäfte mit lokalen Jägern im Inneren Afrikas südlich der Sahara erhielten.

Letztendlich wurden die afrikanischen Elefantenstoßzähne nach Norden transportiert und gelangten in den Handel auf wichtigen Märkten im Nahen Osten. Es ist bemerkenswert, dass der Handel mit Elfenbein auch in Zeiten politischer Unruhen, demografischer Veränderungen und sogar in Zeiten des Zusammenbruchs des Handels mit anderen Rohstoffen wie Silber und Kupfer nicht unterbrochen wurde.
Nach Ansicht der Autoren der Studie deutet hingegen alles darauf hin, dass die Nubier die Elfenbeinhandelsnetze aufrechterhielten, und es ist durchaus möglich, dass es für sie vorteilhaft war, diese aufrechtzuerhalten, obwohl ursprünglich Ägypten die Entwicklung der Handelsnetze gefördert haben könnte.
Diese neue Interpretation widerspricht der traditionellen Vorstellung, dass Ägypten der Hauptvertriebspartner für afrikanischen Elfenbein war. Während ägyptische Quellen dazu neigen, die Nubier als Vermittler darzustellen, scheinen die neuen Daten zu bestätigen, dass sie in Wirklichkeit aktive Teilnehmer waren, die letztendlich den Handel monopolisierten. „Ägypten selbst hat die Entwicklung dieses Handelsnetzes gefördert. Ich denke, dass die Nubier nach dem Niedergang Ägyptens möglicherweise die Initiative übernommen haben. Es gab einen wirtschaftlichen Anreiz, dieses Handelsnetzwerk, dieses Lieferantennetzwerk, aufrechtzuerhalten“, erklärt Shokhat.
Die Studie betont jedoch, dass diese Ergebnisse möglicherweise nicht auf den gesamten alten Nahen Osten übertragbar sind. Elfenbein aus dem nördlichen Levante und Zypern könnte beispielsweise anderen Routen gefolgt sein und aus anderen Quellen stammen. „Die Ausweitung der Isotopen- und Proteomanalyse auf einen umfangreicheren Datensatz könnte dieses Bild noch weiter klären und neue Informationen über die miteinander verbundenen Welten Asiens und Afrikas in der späten Bronze- und Eisenzeit liefern“, schließt der Archäologe.