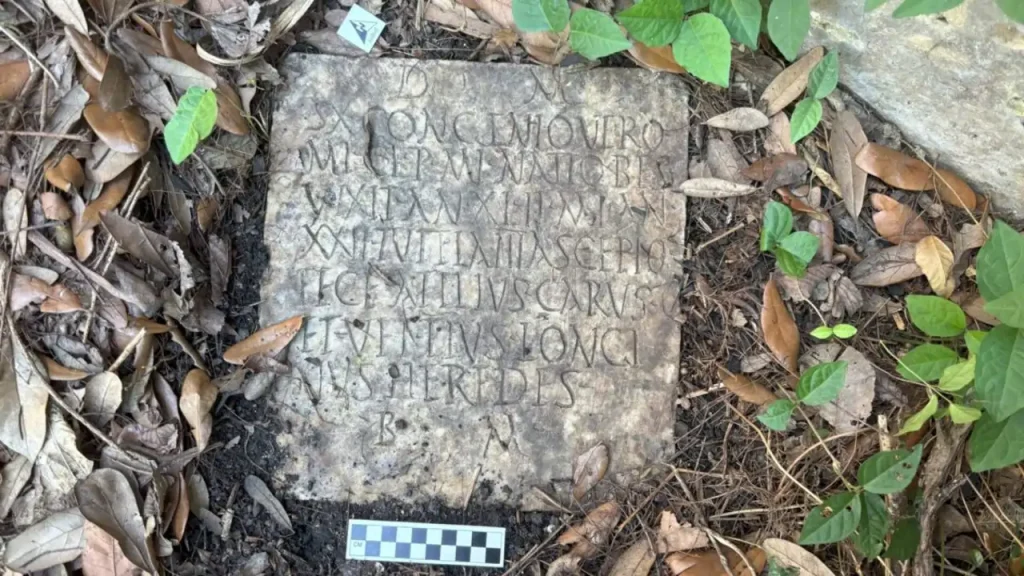Vor einigen Jahren spielte der achtjährige Hugo Dians in einem Wald in der Nähe der Universität von Pennsylvania, als er kleine runde Strukturen in der Nähe eines Ameisennestes bemerkte. Er vermutete, dass es sich um Samen handelte, die von den Bäumen gefallen waren, sammelte sie ein und zeigte sie seinem Vater. Andrew, Professor für Entomologie, erkannte sofort, dass sein Sohn keine Samen gefunden hatte, sondern Eichenkiefer.

Diese Gebilde entstehen, wenn bestimmte Insekten Bäume dazu veranlassen, abnormales Pflanzengewebe zu produzieren, in dem ihre Larven wachsen und sich entwickeln. Keiner von beiden ahnte, dass Eichenknospen Gegenstand einer Studie werden würden, die das Verständnis von Ökologen über die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Insekten neu definierte.
Die Entdeckung eines 8-jährigen Jungen, die die Wissenschaft veränderte
„Myrmekophilie ist ein Mechanismus, mit dessen Hilfe bestimmte Samenpflanzen erreichen, dass ihre Samen von Ameisen transportiert und verbreitet werden. Diese Insekten besitzen die bemerkenswerte Fähigkeit, Samen und Früchte über große Entfernungen zu transportieren, was zu einer besonderen Symbiose mit bestimmten Pflanzenarten führt. Die Samen myrmekophiler Pflanzen haben nahrhafte Anhängsel, sogenannte Elaiosomen, die für Ameisen attraktiv und schmackhaft sind. Samen, die mit diesem Anhängsel versehen sind, werden Diasporen genannt. Der Prozess findet statt, wenn Arbeiterameisen Diasporen sammeln und sie in die Kolonie tragen, wo sie die Elaiosomen zur Fütterung der Larven verzehren und die Samen, denen bereits der Anhang fehlt, in unterirdische Kammern mit organischen Resten legen oder aus dem Nest werfen, was ihre Verbreitung und anschließende Keimung fördert“, erklärt Antropocene.
„Normalerweise verbreiten sich die Samen nicht weit von der Mutterpflanze entfernt. Die Pflanzen profitieren jedoch von dieser Mutualismus-Beziehung mit den Ameisen, da dieser Mechanismus den Transport der Samen an für die Keimung günstige Orte erleichtert und sie vor samenfressenden Raubtieren schützt.
In der Natur wird der Mechanismus der Myrmekochie von mehr als 3000 Pflanzenarten genutzt. Typische Beispiele für Myrmekorie finden sich bei Chelidonium majus, einigen Arten der Gattung Viola, beim Schneeglöckchen (Galanthus nivalis), bei Hepatica nobilis und Anemone nemorosa, bei Onopordum illyricum, Mentha longifolia, Salvia aethiopis, Bixa orellana und vielen anderen Pflanzen.
„Strategische Wespen“
Wenn Gallwespen ihre Eier in Eichen legen, nutzen sie diese Gelegenheit, um chemische Verbindungen einzubringen, die die normale Entwicklung des Pflanzengewebes stören. Der getäuschte Baum bildet eine Art Nähr- und Schutzkapsel um den Embryo der Wespe. Bis zu diesem Zeitpunkt verläuft alles ganz normal.

Erstaunlich ist, was dann passiert: Einige der Eicheln entwickeln eine fleischige rosa Kappe, die für Ameisen äußerst attraktiv ist. Diese Kappe ist reich an Fettsäuren, die denen in toten Insekten sehr ähnlich sind, die für viele Aasfresserameisen eine beliebte Nahrungsquelle sind.
Durch dieses chemische Signal getäuscht, sammeln die Ameisen die Eicheln wie Samen und tragen sie in ihre Nester. Dort fressen sie die Kappe und lagern den Rest der Eichel in unterirdischen Kammern, wo die Wespenlarve vor Raubtieren und ungünstigen Umweltbedingungen geschützt ist.
Mit anderen Worten: Die Wespen manipulieren nicht nur die Eiche, indem sie sie dazu bringen, einen Unterschlupf für ihre Nachkommen zu schaffen, sondern sie manipulieren auch die Ameisen, indem sie sie dazu bringen, als unfreiwillige Wächter zu fungieren.
Kammern und chemische Analyse
Um diese Hypothese zu bestätigen, führten die Forscher eine Reihe von Experimenten durch. Sie platzierten Mägen mit und ohne Kappen in der Nähe verschiedener Ameisenkolonien und filmten deren Reaktionen auf Video. Die Ergebnisse waren eindeutig:
- Die Ameisen trugen die Mägen mit Kappen schnell weg und behandelten sie wie Samen mit Elaiosomen.
- Mägen ohne Kappen wurden ignoriert oder zurückgelassen, was bewies, dass der chemische Köder notwendig war.
Die chemische Analyse bestätigte das Vorhandensein spezifischer Fettverbindungen, von denen bekannt ist, dass sie bei Ameisen eine Sammelreaktion auslösen. Dieselbe Verbindung ist in toten Insekten und in den Elaiosomen von Myrmakokok-Samen vorhanden.
„Am meisten hat mich beeindruckt, dass ich Jahre damit verbracht habe, Insekten zu studieren, und diesen Zusammenhang nicht bemerkt habe“, sagte Andrew Deans in einem Interview.
Diese wissenschaftliche Entdeckung erweitert nicht nur die ökologische Theorie, sondern liefert auch Erkenntnisse, die auf andere Bereiche übertragbar sind. Die Chemie der Kappen könnte beispielsweise als Grundlage für neue Forschungen zu Verbindungen dienen, die Ameisen anziehen. Darüber hinaus scheint die chemische Manipulation, die keineswegs ein seltsames Phänomen ist, vielen Wechselwirkungen zugrunde zu liegen: von Pilzen, die das Verhalten von Insekten steuern, bis hin zu Parasiten, die das Verhalten ihrer Wirte verändern. Was als Kinderspiel begann, führte letztendlich zur Entdeckung einer der komplexesten ökologischen Wechselwirkungen, die heute bekannt sind.