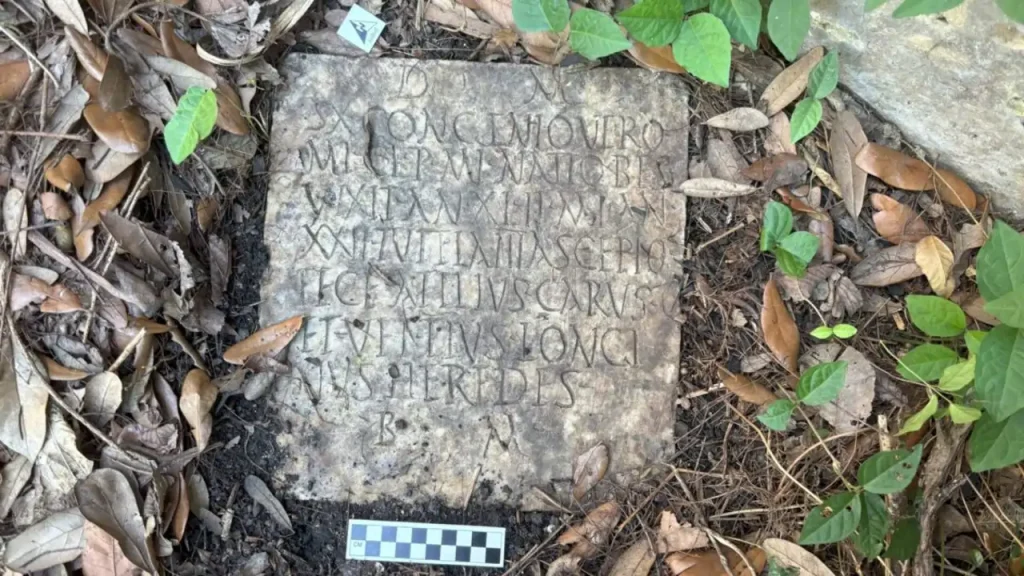Über Jahrhunderte hinweg verbarg der Regenwald im Südosten Mexikos die Spuren einer großen vorspanischen Maya-Stadt, bis zufällig Luke Old-Thomas, ein junger britischer Forscher, der an seiner Doktorarbeit über mesoamerikanische Archäologie arbeitet, zufällig auf einen vergessenen Bericht auf Seite 16 der Suchergebnisse bei Google stieß. Auf den ersten Blick schien das Dokument ganz normal zu sein: eine Untersuchung der Vegetationsdecke, die mit Hilfe der LiDAR-Technologie durchgeführt wurde.

Unter den Bildern der Gegend waren jedoch zu regelmäßige Muster zu erkennen, als dass es sich um natürliche Formationen handeln konnte: gerade Linien, erhöhte Plattformen und symmetrische Strukturen, die an die Grundrisse von Maya-Städten erinnern. Er setzte sich sofort mit der mexikanischen Umweltüberwachungsorganisation in Verbindung, die die Aufnahmen gemacht hatte. Gemeinsam analysierten sie die Rohdaten und bestätigten die Existenz einer unbekannten Maya-Stadt, die unter dem dichten Wald von Campeche verborgen war.
„Valeriana”: die verlorene Maya-Stadt
Sie befindet sich im Bundesstaat Campeche, in einem tropischen Wald im Südosten Mexikos, unweit des gleichnamigen Süßwassersees. Das mexikanische Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte (INAH) gab an, dass sie sich etwa 20 Kilometer südwestlich des Bezirks Chaktun-Tamchen befindet.
Die Stadt wurde Valeriana genannt und nimmt nach vorläufigen Schätzungen eine Fläche von 16,6 Quadratkilometern ein. Sie könnte zwischen 750 und 850 n. Chr., während der klassischen Maya-Periode, zwischen 30.000 und 50.000 Einwohner gehabt haben.
Die Bilder zeigten 6764 Gebäude unterschiedlicher Größe: pyramidenförmige Tempel, Paläste, Wohnplattformen, zeremonielle Plätze und ein ausgedehntes Straßennetz, das die beiden Hauptzentren der Stadt miteinander verband. Eines davon diente laut Archäologen als politisches und religiöses Zentrum, das andere als Verwaltungs- und Handelszentrum.

Die Archäologin Adriana Velázquez Morlet, Direktorin des INAH-Zentrums in Campeche, erklärte, dass „die Bevölkerungsdichte dieser Stadt mit anderen Orten wie Calakmul, Oxpemul und Becan vergleichbar ist”.
Old Thomas kommentierte gegenüber The Guardian, dass „unsere Stichprobe der Maya-Zivilisation lange Zeit insgesamt nur ein paar hundert Quadratkilometer umfasste. Diese Stichprobe wurde von Archäologen mit großer Mühe erhoben, die jeden Quadratmeter sorgfältig untersuchten und die Vegetation mit Macheten rodeten, um zu sehen, ob sie auf einem Steinhaufen standen, der vor 1500 Jahren vielleicht jemandes Zuhause war.“
LiDAR ist die Abkürzung für Light Detection and Ranging (Lichtdetektion und -entfernungsmessung), eine aktive Fernerkundungstechnik, bei der ein auf verschiedenen Arten von Plattformen installierter Sensor kontinuierlich Lichtimpulse aussendet und deren Reflexionen, auch Echos oder Rückstrahlungen genannt, erfasst. Durch Messung der Zeit, in der dieser Lichtimpuls zurückkehrt, kann die zurückgelegte Entfernung berechnet und so dreidimensionale Informationen über die Elemente gewonnen werden.
Eines der Hauptmerkmale dieser Technologie ist, dass der Impuls je nach Frequenz und Intensität der Ausstrahlung Vegetation durchdringen und Informationen über die Struktur von Bäumen liefern kann (was üblicherweise als Durchdringungsfähigkeit bezeichnet wird). Der ausgesendete Impuls trifft auf die Oberfläche und wirkt auf einen Teil des Bodens ein (Spur). Alle reflektierenden Oberflächen innerhalb der Impulsspur erzeugen eine Rückwelle. Die Anzahl der Rückwellen hängt von der Art der Oberfläche ab“, erklärt das Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität.
In der Archäologie hat LiDAR in nur einem Jahrzehnt die Entdeckung ganzer Städte in Guatemala, Belize, Honduras und Südmexiko ermöglicht. Im Fall von Valeriana zeigen die Bilder eine fortschrittliche Stadtplanung mit präzise ausgerichteten Straßen, landwirtschaftlichen Terrassen und Entwässerungskanälen.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Archäologie dank Technologien wie LiDAR, Photogrammetrie und künstlicher Intelligenz erhebliche Veränderungen erfahren. Der Fall Valeriana ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Innovationen
Old-Thomas behauptet: „Meine Arbeit zeigt, dass Archäologen noch nicht alle Orte kennen.“ Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen treibt diese Revolution noch weiter voran. Algorithmen sind in der Lage, Millionen von Datenpunkten zu verarbeiten und architektonische Muster, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, in Echtzeit zu erkennen.
In Zukunft wird die archäologische Forschung zunehmend interdisziplinär werden. Ingenieure, Biologen, Linguisten und Experten für künstliche Intelligenz arbeiten nun mit Archäologen zusammen, um die Geschichte der Menschheit mit bisher unerreichter Detailgenauigkeit zu rekonstruieren.
„Jeder Lichtstrahl, der durch den Dschungel dringt, enthüllt nicht nur alte Steine, sondern auch Fragmente dessen, wer wir waren und wer wir bleiben. Die Technologie ermöglicht es uns, dort zu schauen, wo früher nur Schatten waren, aber die wahre Offenbarung liegt in der Erkenntnis, dass diese verlorenen Städte nicht der Vergangenheit angehören, sondern Teil einer lebendigen Geschichte sind, die unter unseren Wurzeln noch immer atmet. Valeriana ist kein Einzelfall: Sie erinnert uns daran, dass die menschliche Neugier nach wie vor das mächtigste Instrument ist, um uns selbst neu zu entdecken“, erinnern die Experten.